Wandel der Städtepartnerschaft
Vom Bevölkerungstreff zur strategischen Beziehung Exklusiv
Die Idee der Städtepartnerschaft entstand nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst als deutsch-französische Initiative, um sich nach zwei Weltkriegen wieder einander anzunähern. Ist das Konzept der Städtepartnerschaft von heute noch vergleichbar mit dem damaligen, beziehungsweise ist es noch zeitgemäß?
Wir differenzieren in Oldenburg zwischen Städtepartnerschaften mit historischer Funktion, wie die mit Frankreich – diese haben sich ein Stück weit überlebt – und den neuen Verbindungen, die sich als strategische Partnerschaften beschreiben lassen. Der Unterschied besteht vor allem darin, dass letztere anfangs nicht formalisiert sind. Es gibt von beiden Seiten zunächst nur eine Absichtserklärung zur Kooperation. Anhand konkreter Projekte zeigt sich die Zusammenarbeit später, wie die bereits genannte Teilnahme an der Weltgartenbauausstellung.
Ich denke, dass der Ideenaustausch zu bestimmten Themen, wie Verbesserungsmöglichkeiten des Alltagslebens in den Kommunen und auf der operativen Ebene der Stadtverwaltung, für beide Seiten sinnvoll ist. Inhalte sind zum Beispiel: Wie organisiert ihr den öffentlichen Nahverkehr, wie organisiert ihr die Abfallwirtschaft, wie organisiert ihr Energiekreisläufe.
Was heutzutage nicht mehr gut funktioniert, sind größer angelegte Treffen der Bevölkerung, wie damals mit Frankreich. Viele Sport-, Kultur- und Heimatvereine auf beiden Seiten trafen sich nach dem Krieg, die Busse fuhren hin und her. Das hat ausgedient. Die Grenzen sind heute durchlässiger. Es ist nicht mehr notwendig, über eine organisierte Städtepartnerschaft das Wissen über die Partnerstadt und das jeweilige Land zu organisieren.
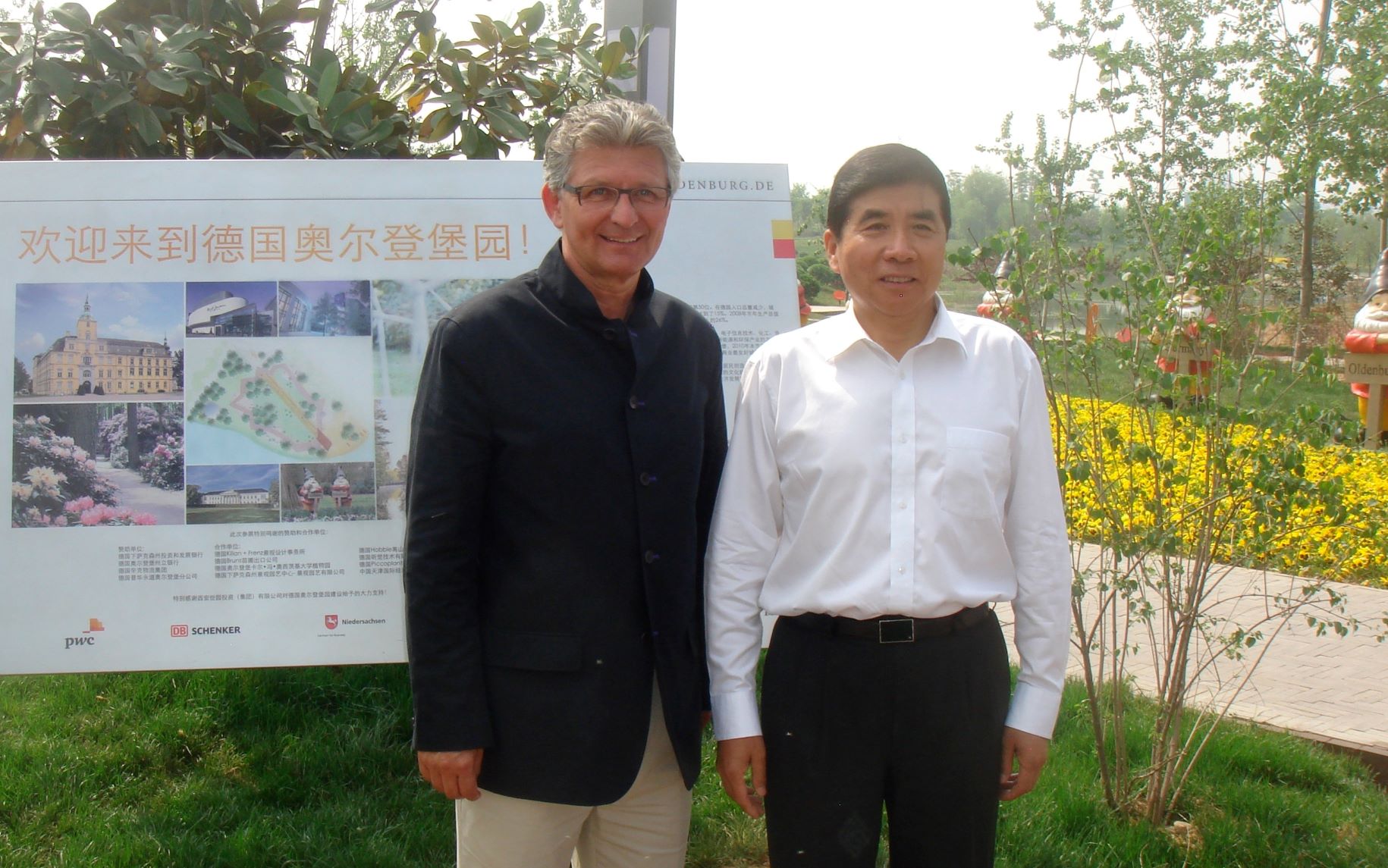
Prof. Gerd Schwandner trifft sich mit dem frühreren Xi'ans Bürgermeister Chen Baogen während der Gartenbauausstellung (Foto vom April 2011, mit freundlicher Genemigung von Prof. Gerd Schwandner)
Wie hat Oldenburg von dieser Partnerschaft profitiert?
Die Partnerschaft war Teil unserer Internationalisierungsstrategie. Oldenburg hat verstanden, dass sich die Stadt anders aufstellen muss – nicht im Sinne von Arbeitsplätzen oder Bruttosozialprodukt – sondern in Bezug auf ihr Prestige. Das Bild, was man von Oldenburg hat, ist heute ein anderes als das von vor 15 Jahren. Sich nach außen öffnen, das Image einer internationalen Stadt aufbauen. Das war das Ziel und das ist uns gelungen.
Welchen wirtschaftlichen Nutzen haben Städtepartnerschaften?
Es geht vorrangig um den gezielten Austausch bestimmter Gruppen, von Wirtschaft und Wissenschaft. Das haben wir von Anfang an so gehandhabt. Bei Delegationsreisen und Austausch waren immer diese zwei Gruppen vertreten.
Man kann aber nicht erwarten, dass sich bei einem einmaligen Treffen sofort ein wirtschaftlicher Nutzen ergibt. Das dauert oft Jahre. Es ist einfacher, wenn man eine heimische produktionsorientierte Wirtschaftsstruktur hat. Das war die Schwäche von Oldenburg, weil Oldenburg eine Dienstleistungsstadt ist mit vielen Banken und Versicherungen. Einfacher war es im Bereich IT, weil Oldenburg von der Universität her sehr stark IT-orientiert ist und über den Energieversorger EWE sehr früh auf erneuerbare Energie gesetzt hat. Wir haben eine hohe Kompetenz, wie man zum Beispiel ein Netz organisiert, was über erneuerbare Energien gespeist wird, wenn nicht immer die Sonne scheint und nicht immer der Wind weht. Eines der Projekte, das entstanden ist, weil wir immer auch einen Wissenschaftler mit dabeihatten, war, dass die Wissenschaftler der EWE eine Studie für China geschrieben haben mit der Frage: Wie organisiert man in China ein Stromnetz, das vor allem aus erneuerbarer Energie gespeist wird.


8915fcde-e1df-4f66-b71c-20e267ec868a_cut.jpg)








